Auf unseren Artikel „Die ,Mobile-First‘-Bank“ im Februar gab es mehrere Kommentare für und gegen die Automatisierung von Post- und Bank-Leistungen

Fotos: H. Kahle
Im Februar berichteten WIR über die angekündigte Schließung der Post und der Postbank im Luna-Center und die schrittweise Einstellung aller Postbank-Leistungen im Postshop in der Veringstraße. Als „letzte Meldung“ berichteten WIR, dass nun auch der defekte Geldautomat aus der Mauer neben dem Eingang entfernt worden war. Diese Meldung korrigierte ein Leser kurz darauf: Bereits wenige Tage nach dem Ausbau sei ein neuer Geldautomat in dem Mauerloch installiert worden. Der Neue ist, wie ein anderer Leser kommentierte, ein Bankomat des amerikanischen Anbieters Western Union, mit dem die Deutsche Bank zusammenarbeitet.
Die Grundversorgung
Ein Leser wies in seinem Kommentar auf die „Grundversorgung“ hin, zu der die Post nach dem Postgesetz verpflichtet sei.
Mit der „Grundversorgung“ ist das allerdings so eine Sache. Tatsächlich ist die Post nach dem Postgesetz verpflichtet, in Wohngebieten ab 4.000 Einwohner*innen Filialen einzurichten, die in maximal 2.000 Metern erreichbar sein müssen. In der Praxis verstieß die Post in den letzten Jahren immer häufiger gegen diese Filialnetzpflicht. Nach Pressemeldungen fehlten 2024 deutschlandweit bereits 141 Filialen an „Pflichtstandorten“. Die Bundesregierung reagierte auf diese Situation im vergangenen Jahr mit einer Novellierung des Postgesetzes. Als Postfilialen im Sinne des Gesetzes können in Zukunft auch Postautomaten gelten, an denen Briefe und Pakete aufgegeben und abgeholt und Marken gekauft werden können. Die ersten neun Automatenstationen hat die Bundesnetzagentur auf der Grundlage der Gesetzesänderung als „Filialen“ genehmigt, allerdings keine davon in Hamburg. Die Deutsche Post lobt die „kundenfreundliche Automatenlösung, die rund um die Uhr verfügbar ist“.
Außerdem wurde im erneuerten Postgesetz, neben einer Erhöhung des Portos, die Laufzeit der Zustellung verlängert. Briefe müssen ab 2025 statt, wie bisher, bis zum folgenden Werktag, erst bis zum dritten Werktag zugestellt werden. Alle diese Änderungen sind Teil eines umfassenden Sparprogramms, bei dem unter anderem bis Ende des Jahres 8.000 Stellen im Brief- und Paketgeschäft gestrichen werden sollen.
Die Postbank

Postbank-Geschäfte konnte man zwar lange in den Post-Partnerfilialen, wie der in der Veringstraße, abwickeln. Aber die Postbank – schon lange Teil der Deutschen Bank – hat eigentlich mit der Post nichts zu tun und unterliegt nicht der Verpflichtung zur Grundversorgung nach dem Postgesetz. Die schrittweise Einstellung aller „physischen“ Dienstleistungen zugunsten der digitalen „Mobile-First“-Bank begründet die Postbank mit „geändertem Kundenverhalten“, der Entwicklung zum Online-Banking. Ein WIR-Leser äußert in Kommentaren Verständnis für diese Entwicklung. Ein anderer Leser kritisiert, dass in den Stellungnahmen der Bank als Kund*innen, die sich mit dieser Entwicklung schwertun, vor allem alte Menschen angeführt werden. Es gebe auch Kund*innen, die ein Beratungsgespräch am Schalter möchten oder Ladenbesitzer, die Bareinzahlung machen wollen.
Der Digitalzwang
Der Verein „Digitalcourage e. V.“ verlangt, das „Recht auf ein analoges Leben ohne strukturelle Nachteile“ im Grundgesetz zu verankern: „Das Grundgesetz verteidigt die freie Entfaltung der Persönlichkeit und stellt alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Doch mit zunehmendem Digitalzwang entsteht eine neue Form der Ausgrenzung.“
Dazu befand der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages im Juli 2024 in einer Stellungnahme zum Onlinezugangsgesetz – Art. 1 Nr. 1 OZGÄndG zu § 1a OZG: „Aufgrund der hohen Digitalaffinität der unternehmerischen Verwaltungskunden und der bereits jetzt überwiegend digitalen Inanspruchnahme von unternehmerischen Verwaltungsleistungen sowie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist die Aufrechterhaltung eines analogen Zugangskanals für Verwaltungsleistungen im unternehmerischen Kontext im Regelfall nicht zu rechtfertigen … (Der Ausschuss) ist der Auffassung, dass die in der Wirtschaft und Gesellschaft weit vorangeschrittene digitale Transformation und die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung dafür sprechen, bestimmte Verwaltungsleistungen ausschließlich digital zugänglich zu machen.“ Auf Deutsch: Der „Digitalzwang“ ist rechtmäßig!
Mit den „Alten“ darf man dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages nicht kommen. Und eine zukunftsorientierte Kritik der Digitalisierung des alltäglichen Lebens steht erst in den Anfängen.



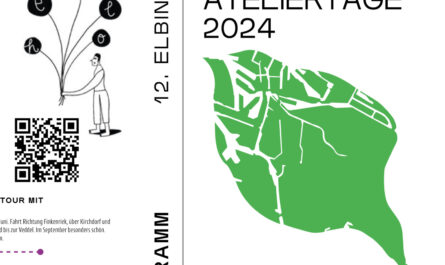

In den zitierten Passagen der Stellungnahme des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestage zum Onlinezugangsgesetz ist ausschließlich von unternehmerischen Verwaltungskunden und den Verwaltungsleistungen im unternehmerischen Kontext die Rede.
In diesem Kontext sprechen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung dafür, bestimmte Verwaltungsleistungen ausschließlich digital zugänglich zu machen.
Auf Deutsch:
Unternehmerischen Verwaltungskunden wird der »Digitalzwang« auferlegt.
Was das mit den „Alten“ zu tun hat, erschließt sich mir nicht.