WIR und die Bücherhalle Wilhelmsburg haben wieder für euch gestöbert!
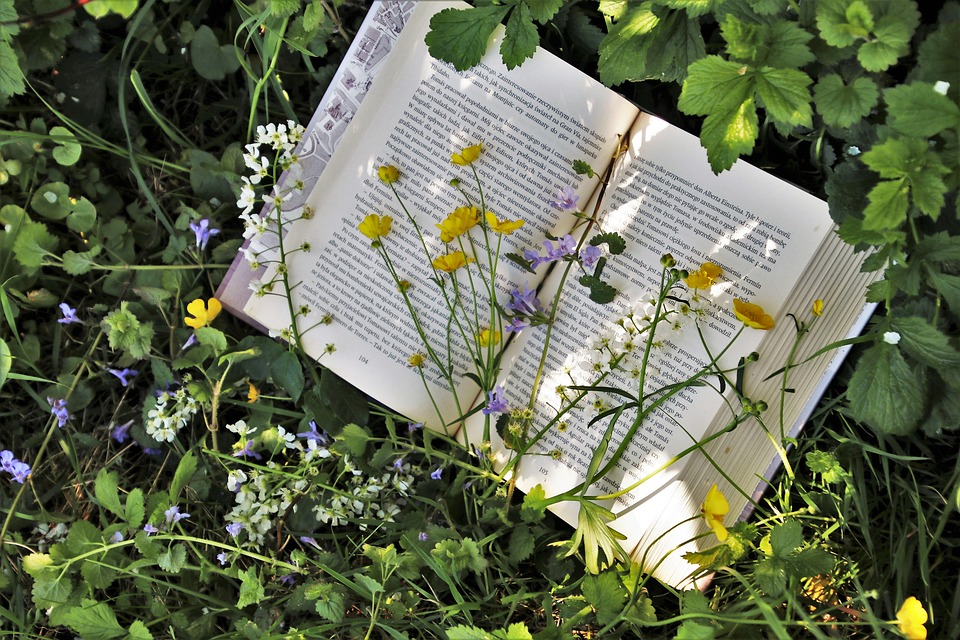

Alle Bücher, die als [Gewinn] gekennzeichnet sind, verlosen WIR unter den Rätseleinsender*innen seit Januar 2025! Schreibt gerne dazu, welches Buch euch besonders interessiert. WIR versuchen, den Wunsch zu berücksichtigen.
In unserer Juli-Hauptausgabe, die am 23. Juli erscheint, veröffentlichen WIR den 2. Teil unserer Lesetipps. Dort findet ihr auch die Tipps aus der Bücherhalle.
Die Postkarte
Das Buch ist nicht nur eine beeindruckende Familiengeschichte sondern auch ein wichtiges Zeugnis jüdischen Lebens in Frankreich während und nach dem Zweiten Weltkrieg

Marianne Groß. Mit „Die Postkarte“ gelang Anne Berest ein literarischer Coup. Das Buch war auf der Shortlist der großen Literaturpreise in Frankreich und stand mehr als zwei Jahre auf der Bestsellerliste.
Lélia, die Mutter der Autorin, erhält eine Postkarte, die in unbeholfener Handschrift nur die vier Namen Ephraim, Emma, Noémie und Jaques aufweist. Es sind die Vornamen ihrer Großeltern mütterlicherseits, ihrer Tante und ihres Onkels. Alle vier waren 1942 in Auschwitz gestorben. Die Postkarte gibt der ganzen Familie Rätsel auf. Dennoch wird sie zunächst nicht weiter beachtet, bis Anne Berest zehn Jahre später, kurz vor der Geburt ihres Kindes, unbedingt die Geschichte ihrer Vorfahren kennenlernen will.
Wie sie dann die einzelnen Stationen der Nachforschungen zusammen mit ihrer Mutter Lélia erzählt, ist äußerst spannend. Sie finden heraus, dass die Urgroßeltern als jüdische Familie Russland verließen und nach Palästina gingen. Den Sohn Emmanuel zog es nach Paris. Sein Bruder Ephraim wanderte mit seiner Frau Emma und dem Baby Myriam, der Mutter von Lélia und der Großmutter von Anne nach Lettland aus. Später macht Ephraim in Frankreich Karriere und will sich einbürgern lassen. Er verpasst den richtigen Zeitpunkt einer Auswanderung nach Amerika. Am Ende überlebt nur Myriam. Ihre Eltern und ihre Geschwister Noémi und Jaques starben in Auschwitz.
Anne Berest, Die Postkarte, Piper, 544 Seiten, 16 Euro [Gewinn]
SEE.NOT.RETTUNG.
„Meine Tage an Bod der SEA-EYE 4“ ist ein bewegender Bericht über das Schicksal Geflüchteter an der gefährlichsten Meeresgrenze der Welt
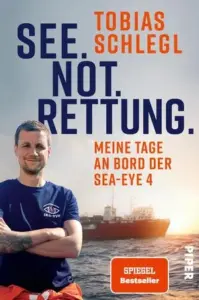
Marianne Groß. Hautnah dabei – über mehrere Wochen half Tobias Schlegl als Notfallsanitäter bei der Rettung Geflüchteter aus Seenot vor der Küste Libyens. Es wurde eine aufreibende Zeit für die Crew und ihn. Erst Schwierigkeiten bei Übungseinsätzen und das bange Warten auf den ersten Einsatz, dann Notrufe, Verfolgungsjagden mit der libyschen „Küstenwache“ und Menschen im Wasser. Schließlich die quälende Suche nach einem sicheren Hafen für die mehr als 400 Geretteten. Schlegls Aufzeichnungen machen die menschliche Tragödie erfahrbar, die sich Tag für Tag vor den Mittelmeerküsten abspielt.
Sehr persönlich und offen schreibt Tobias Schlegl über Ängste und Fehler, ist nachdenklich und ehrlich. Einfühlsam schildert er Szenen aus dem Schiffsalltag und zeigt die Menschen um ihn herum – auch die Geretteten, die durch die Hölle gegangen sind und nun an Bord eine Zeit voller Hoffnung erleben.
Tobias Schlegl, See.Not.Rettung., Piper, 224 Seiten, 16 Euro [Gewinn]
Von Rehen und Menschen
Martina Behm hat mit „Hier draussen“ einen Dorfroman geschrieben, der keiner ist
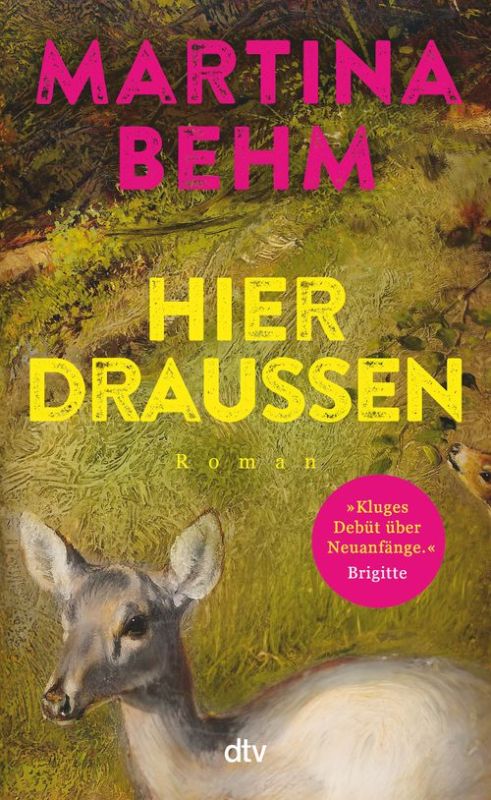
Sigrun Clausen. Die Frage nach dem eigenen Lebensentwurf, die Kluft zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, die Sehnsucht nach Gemeinschaft und gleichzeitig nach Individualität … die Autorin Martina Behm zeigt uns mit ihrem Roman, der in einem Kleinstdorf ungefähr eineinviertel Autostunden nördlich von Hamburg spielt, dass diese Konflikte nicht nur für „moderne“ Großstädter*innen existieren. Den Bewohner*innen von Fehrdorf – so heißt der Dorfschauplatz im Roman – stellen sich diese Fragen ganz genauso, nur vor einem anderen gesellschaftlichen Hintergrund und unter anderen räumlichen Gegebenheiten.
Die Figuren in Martina Behms Roman „Hier draussen“ fühlen sich alle auf unterschiedliche Art unwohl in ihrem Leben – manchen fehlt nur eine Kleinigkeit, andere leiden regelrecht, wieder andere sind enttäuscht von einem vermeintlichen Neuanfang.
Die Geschichte beginnt aus der Perspektive der „Zugezogenen“ aus Hamburg, Lara und Ingo mit ihren zwei Kindern, die den alten Resthof am Dorfrand gekauft haben. Sie sind es, deren Neuanfang in Scherben liegt – das Landleben hat keine Ruhe und Innigkeit gebracht, im Gegenteil, Ingo und Lara sind weiter voneinander entfernt denn je. Doch auch vom Dorfleben sind sie entfernt, in den drei Jahren ihres ländlichen Daseins sind sie außen vor geblieben, auch, weil sie nicht wirklich Anschluss gesucht haben.
Das ändert sich, als Ingo nachts auf dem Heimweg von seiner Hamburger Agentur eine weiße Hirschkuh anfährt. Plötzlich ist er auf die Hilfe des Jagdzuständigen von Fehrdorf, Uwe, angewiesen. Mit Uwes Blick nimmt uns die Erzählerin Stück für Stück mit in die Dorfgemeinschaft, wir lernen die weiteren Hauptfiguren kennen, die alle ihre ganz eigenen Fragen an ihr Leben stellen. Auch die Perspektive von Lara und Ingo wendet sich langsam von außerhalb stehenden Beobachter*innen zu Miterlebenden, Mitgestaltenden.
Martina Behm lässt die Personen abwechselnd aus der Ich-Perspektive erzählen. So haben wir als Leser*innen einerseits das Gefühl, unmittelbar an den Gedanken, Beobachtungen und Emotionen der Figuren teilzuhaben, andererseits erleben wir immer wieder überrascht, wie unterschiedlich ein Ereignis von verschiedenen Menschen wahrgenommen werden kann. Sehr gelungen ist auch die Einteilung des Romans in fünf Teile mit insgesamt 47 Abschnitten, die alle Überschriften aus Wörtern mit ländlichem, bäuerlichem Bezug haben.
Die Autorin schreibt in einer klaren, schnörkellosen Sprache, vollkommen unsentimental und doch mit Gefühl. Die norddeutsche Dorftristesse inklusive ritualisiertem Alkoholmissbrauch, industrieller Tierhaltung, der Kiesgrube um die Ecke und dem allgegenwärtigen Schweigen wird ebenso spürbar wie die Zärtlichkeit Uwes gegenüber seinen Tieren, die Schönheit eines aus der Dämmerung auftauchenden Damwildrudels oder die Wohligkeit des morgendlichen Erwachens neben einer geliebten Person.
Das liest sich schön und mensch bangt schon nach wenigen Seiten mit den Figuren mit und ist dann froh, wenn Martina Behm ihnen gegen Ende des Romans doch den einen oder anderen positiven Ausblick schenkt.
Martina Behm, Hier draussen, dtv, 487 Seiten, 24 Euro
Schönen Gruß, der Kampf geht weiter
In der neuen Rowohlt-Biographie von Alexander Solloch erfahren die Leser*innen viele noch unbekannte Geschichten aus dem Leben des großen Übersetzers und Klönschnackers
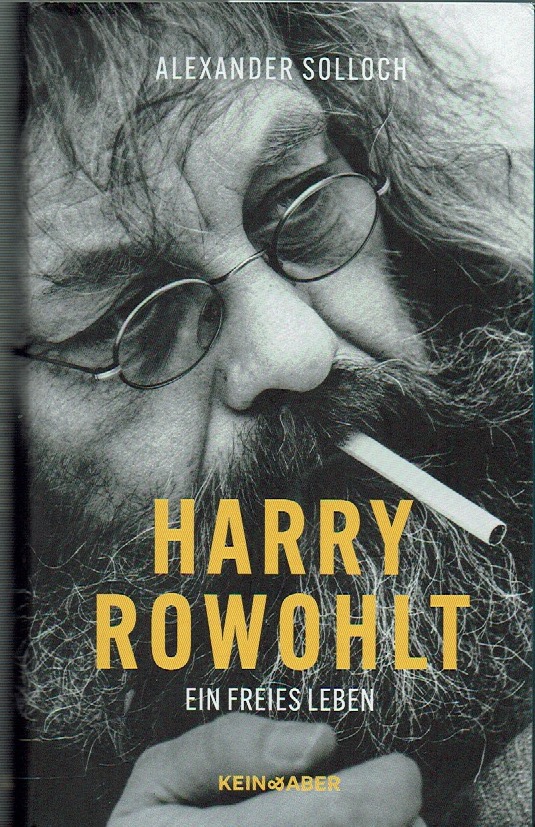
Ausgerechnet am 15. Juni, dem „Veteranentag“, war Harry Rowohlts zehnter Todestag. Einen großen Übersetzer, begnadeten Klönschnacker und Humoristen ehrt man am besten mit einem Buch, bei dem man manchmal mit dem Lachen nicht aufhören kann.
Die gerade erschienene Biografie „Harry Rowohlt – ein freies Leben“ von Alexander Solloch ist so ein Buch. Der Autor betont im Vorwort, dass er zwar journalistisch distanziert, jenseits aller Legenden und Anekdoten, Rowohlts Leben beschreibe, er könne aber nicht bestreiten, dass „der Mann und sein Werk ihm recht sympathisch seien.“
Solloch hat mit vielen Zeitzeug*innen gesprochen. Zusätzlich hatte er Zugriff auf das Privatarchiv, das Rowohlts Frau Ulla ihm überließ. So erfahren die Leser*innen, dass Rowohlts Großmutter wohl doch keine „italienische Zigeunerin“ und Cousine zweiten Grades von Claudia Cardinale gewesen ist und sein Großvater auch nicht einer der ersten Minister der Sowjetunion und kurz darauf Mitbegründer der USPD. Und Harry Rowohlt, der sich selber gern als Kommunist bezeichnete, sei wohl eher, wie Gregor Gysi zitiert wird, ein „eigenständig und ungewöhnlich denkender“ Linker gewesen. Gemeinsam mit Gregor Gysi hatte Rowohlt unter anderem ein Hörbuch mit Marx-Engels-Texten aufgenommen. Briefe unterzeichnete er schon mal mit „Schönen Gruß, der Kampf geht weiter, Gottes Segen und Rot Front“.
Alexander Solloch beschreibt ausführlich die komplizierten Familienverhältnisse und Harrys langen und mühseligen Ablösungsprozess vom väterlichen Rowohlt-Verlag, mit dem er später nichts mehr zu tun hatte. In mehreren Textvergleichen bekommt man einen Eindruck davon, was das Besondere an den Übersetzungen Rowohlts war, die ihn – obwohl nur Übersetzer und Erfinder origineller und grotesker deutscher Wörter für vermeintlich Unübersetzbares – zu einem gefeierten Literaten machten. Solloch zitiert einen nicht belegten Ausspruch eines Lektors: „Das Buch musst du in Harry Rowohlts Übersetzung lesen, im Original geht da vieles verloren.“
Rowohlt-Fans, die seine unnachahmlichen, prallen, bis zu fünfstündigen Lesungen, das „Schausaufen mit Betonung“, miterlebt haben, erfahren, dass er anfangs ein eher schüchterner und unsicherer Vorleser gewesen ist und erst im Laufe der Jahre zum großen Klönschnacker wurde. Und sie erfahren, dass einer seiner letzten öffentlichen Auftritte am 30. Mai 2013 im Rialto-Kino in Wilhelmsburg stattfand – er erhielt dort den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. Das stand nicht mal im WIR.
Alexander Solloch ist Literaturredakteur beim NDR. Er schreibt selbst machmal etwas „rowohltsch“ und am lustigsten ist es natürlich immer, wenn er Harry zitiert. Eine schöne Anekdote kommt allerdings nicht vor, die geht so: Auf die (immer wieder gestellte) Frage, ob es nicht sehr lästig sei, den berühmten Namen Rowohlt zu tragen, antwortete Harry: „Ich bin ja froh, dass ich nicht Kiepenheuer und Witsch heiße.“
Für Kenner*innen der autobiographischen Rowohlt-Bücher „Nicht weggeschmissene Briefe“ und „In Schlucken zwei Spechte“ ist Alexander Sollochs Biographie „Harry Rowohlt – ein freies Leben“ eine ausgezeichnete Ergänzung. Für die, die oben genannte Bände nicht kennen, ist sie eine ausgezeichnete Einstiegsdroge.
Alexander Solloch, Harry Rowohlt – ein freies Leben, Verlag Kein und Aber, 278 Seiten, 26 Euro




